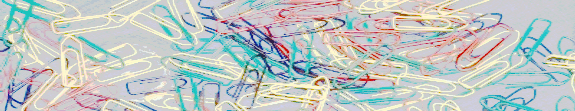Rechtsgeschichte hat viel zu sagen
Helmut Kramer
Warum die jüngste Rechtsgeschichte uns soviel zu sagen hat (Referat auf der Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung am 1. und 2. Juni 2006)
Wenn man den Bekenntnissen von Justizpolitikern und den Vorgaben der Ausbildungsgesetze vertraut, ist die Welt der Juristen in Ordnung. Danach ist die Juristenausbildung gerichtet auf den „aufgeklärt handelnden Juristen“ mit rechts- und sozialwissenschaftlich fundiertem Durchblick und der Fähigkeit zur methodenorientierten Entfaltung der Gesetzesnormen. Von diesem Anspruch ist die Ausbildungswirklichkeit weit entfernt. Unsere Juristen durchlaufen die seit 1869 nahezu unveränderte Ausbildung, von der schon die Juristen der Jahre 1913, 1933, 1943 und 1953 ihre Prägung erhalten hatten.
Noch immer dient die universitäre Ausbildung überwiegend der Anhäufung möglichst flächendeckenden Wissens in möglichst vielen examensrelevanten Fächern. Für eine methodisch reflektierte, vertiefende Durchdringung des Rechtsstoffs unter Einbeziehung seiner historischen, philosophischen, sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen bleibt keine Zeit. Das unkritische Auswendiglernen von Lehrmeinungen und eine eher dressurmäßig als methodenbewusst eingepaukte, allein auf das Examen ausgerichtete Klausurtechnik lassen das Kritik- und Reflexionsvermögen der angehenden Juristen systematisch verkümmern. Anstelle eigenständigen Denkvermögens wird ihnen die Selbstgewissheit vermittelt, ihre Entscheidung sei das zwingende Produkt einer rein logischen Operation.
Tatsächlich muss der gute Jurist beides können: er muss das juristische Handwerkszeug, das rechtstechnische Instrumentarium möglichst gut beherrschen. Gerade wegen der Missbräuchlichkeit der juristischen Methode – sie kann in den Dienst rechtsfremder Zwecke gestellt werden – muss er aber auch bereit und in der Lage sein, das methodische Instrumentarium einschließlich der „herrschenden Meinungen“ kritisch und selbstkritisch zu hinterfragen; er muss die Methode gewissermaßen gegen den Strich bürsten können.
Wohl die beste Möglichkeit, ein solches Reflexionsvermögen auszubilden, bietet die Rechtsgeschichte. Die rechtshistorische Rückschau macht die Irrtumsanfälligkeit des juristischen Methodenarsenals mit seiner nahezu beliebigen Verwendbarkeit besonders augenfällig. Während im Widerstreit der rechtspolitischen Auseinandersetzungen der Gegenwart der Blick dafür, was „Recht“ sein soll, noch getrübt sein kann, haben sich im geschichtlichen Rückblick mit verblassender aktuellpolitischer Relevanz die Nebel etwas gelichtet. Die Zeitbedingtheit, Interessen- und Ideologieabhängigkeit des Rechts – genauer: des durch unkritische Juristen verwalteten Rechts – wird im Spiegel der Rechtsgeschichte besonders deutlich, auch die Gefahr der Verführbarkeit des Juristen durch die Macht. Das Versagen von Juristen im 20. Jahrhundert, ja dass viele von ihnen in den Jahren 1933 bis 1945 zu Verbrechern in der Robe werden konnten, war nicht zuletzt durch ihre Ausbildung und berufliche Sozialisation bedingt. Was die Ausbildung schon der Jahre und Jahrzehnte vor 1933 den meisten Juristen nicht vermittelt hatte, war – neben einem Quantum an Zivilcourage, also Bereitschaft zu notwendigem Widerspruch – die Befähigung, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründe des Rechts zu erkennen und die Funktion des Juristen in der Gesellschaft zu hinterfragen. Der „furchtbare Jurist“ der NS-Zeit war zugleich ein unkritischer Jurist im Dienst der Macht.
Das Verhalten der Juristen in den Jahren 1933-1945, zum Teil auch in der Zeit der Weimarer Republik, vermittelt eine einzigartige Anschauung dafür, dass technische Berufsqualitäten auch ins Gegenteil umschlagen können. Hier gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie Richter mit größter Selbstsicherheit im Wege einer vermeintlich korrekten, mitunter geradezu subtilen Handhabung eines hochdifferenzierten Begriffsinstrumentariums noch das schlimmste Unrecht mit juristischer Eleganz legalisiert haben. Die Juristen des Dritten Reiches kamen nicht trotz ihrer meist noch vor 1933 absolvierten, rechtstechnisch gediegenen Juristenausbildung und beruflichen Sozialisation, sondern mit Hilfe des erlernten Methodeninstrumentariums zu ihren unmenschlichen Entscheidungen. Viele von ihnen waren nicht einmal fanatische Nationalsozialisten. In ihrer unkritischen Mentalität merkten sie nur nicht, wie sehr sie sich im Dienst der nationalsozialistischen Ideologie instrumentalisieren ließen.
Auch die DDR-Justiz und die Justiz in der Frühzeit der Bundesrepublik sind ein hervorragender Gegenstand des Lernens. Wie viele Juristen wissen heute noch von der sog. Naturrechtsprechung des Bundesgerichtshofs, zum Beispiel von der restriktiven Rechtsprechung des BGH zur Gleichberechtigung der Geschlechter oder zum Verbot der „Unzucht“ unter Verlobten? Auch von der hybriden Staatsschutzrechtsprechung im Kalten Krieg erfahren die angehenden Juristen in ihrer Ausbildung nichts. Nachdenklich machen könnte hier vor allem, dass sich diese Rechtsprechung unter dem heiteren Himmel von Rechtsstaat, Demokratie und richterlicher Unabhängigkeit ereignen konnte. Dasselbe gilt von der BGH-Rechtsprechung der fünfziger und sechziger Jahre, mit der die allermeisten Täter der NS-Gewaltverbrechen, insbesondere die Schreibtischtäter, von Strafe verschont wurden und sämtliche der rund 60.000 Todesurteile des Dritten Reiches ungesühnt blieben? Würden sich die Juristen von heute damit beschäftigen, würden sie erkennen, wie sehr Juristen politischen Vorgaben und weltanschaulichen Vorverständnissen folgen können. Und wie sehr sie ihre politischen Absichten mit scheinbarer juristischer Exaktheit verschleiern können. Wie sehr sie mit rechtstechnischer Akrobatik vor noch so fragwürdigen Entscheidungen eine Legalitätsfassade errichten können.
Ein besonders lohnendes Objekt für die Einübung in die notwendige Selbstkritik ist die unterschiedliche strafrechtliche Aufarbeitung der NS- und SED-Verbrechen. Mit der krass widersprüchlichen Entscheidungspraxis in Fällen von im Staatsinteresse begangenen Unrechts liefert dieser Teil der jüngsten Rechtsgeschichte ein hervorragendes Anschauungsmaterial als Warnung vor allzu großer Selbstgewissheit der Juristen. Hier findet man kaum eine Gesetzesnorm, keine Rechtsfigur, keinen Denkansatz, keine einzige Rechtskonstruktion, die nicht gegenüber NS-Tätern einerseits und DDR-Tätern andererseits diametral, gewissermaßen um 180 Grad entgegengesetzt angewandt worden ist, mit atemberaubend konträren Ergebnissen bei gleichartigem Sachverhalt. Ergebnisse, die sich jeweils „zwingend“ aus einer rein rechtlichen, von politischen Vorverständnissen freien, rein logischen Operation ergeben sollen, die aber nur durch das Messen mit zweierlei Maß erzielt werden konnten.
Damit sind die Gründe für die Unverzichtbarkeit der Rechtsgeschichte aber noch nicht vollständig beschrieben. Das geltende Recht und seine Funktionsweise lassen sich nicht ohne Kenntnis der historischen Entstehung und Entwicklung richtig erschließen. Für das Verständnis des Rechts und damit für die Rechtskultur insgesamt ist die Rechtsgeschichte unverzichtbar. Rechtsbewusstsein und Rechtsgeschichte sind untrennbar. Schon Theodor Mommsen sagte: Um „Einsicht in das innere Räderwerk des Rechts“ zu nehmen, bedürfe es der „Verschmelzung von Geschichte und Jurisprudenz“ (Gesammelte Schriften, Bd. 3, Berlin 1907, S. 600; ders., Reden und Aufsätze, Berlin 1905, S. 36).
Das lässt sich konkretisieren: Gerade die Einbeziehung der Entstehungsgeschichte von Gesetzen und „herrschenden Meinungen“ kann für die heutige Rechtsanwendung die Augen überraschend öffnen. Diese Entstehungsgeschichte ist für die Entscheidung aktueller Rechtsprobleme oftmals unverzichtbar. Hier nur ein einziges Beispiel: Das Rechtsberatungsgesetz, insbesondere das verfassungsrechtlich unhaltbare Verbot der altruistischen Rechtsberatung, stammt aus dem Jahre 1935. Und die erweiterte Auslegung dieses Verbots hat seinen Ursprung in einer Entscheidung des Reichsgerichts von 1938. Auch sonst schleppt die Rechtsprechung bis heute aus der NS-Zeit herrührende Rechtsfiguren und herrschende Lehren vielfach unreflektiert fort. Höfliche Hinweise auf die Ursprünge solcher „herrschenden Meinungen“ werden in richterlichen Entscheidungsbegründungen aber meist mit „dröhnendem Stillschweigen“ übergangen. Tatsächlich kann die Kenntnis der Rechtsgeschichte dazu beitragen, verfassungsrechtlich und rechtspolitisch bedenkliche Positionen zu korrigieren.
Ein anderes Beispiel dafür, wie mit Hilfe des juristischen Methodeninstrumentariums auch schlimmstes Unrecht mit dem Schein des Rechts versehen werden kann, ist der Versuch des Reichsjustizministeriums, die Folterpraxis der Gestapo zu „verrechtlichen“. Dort beschloss man auf einer Konferenz vom 4. Juni 1935 Richtlinien, in denen die Voraussetzung für die Geständniserzwingung durch Folter festgelegt wurden. Der Begriff Folter wurde durch den Begriff „verschärfte Vernehmung“ ersetzt und mit der „Bestimmung eines Einheitsstocks, um jede Willkür auszuschließen“, wurde rechtsstaatliche Korrektheit vorgetäuscht. Um auf die Aktualität des gefährlichen Missbrauchs von Rechtskonstruktionen aufmerksam zu machen, braucht man nicht nur an die aus Guantanamo und dem Irak bekannt gewordene Vernehmungspraxis des UN-Militärs und an den Erlass von diese Praxis abdeckenden Rechtsvorschriften durch das Washingtoner Justizministerium und das Pentagon zu erinnern.
Angesichts dieser Zusammenhänge ist es unverständlich, dass die Rechtsgeschichte aus der heutigen Ausbildung nahezu verschwunden ist, allenfalls nur noch ein Nischendasein führt. Weitgehend auf dem Papier steht auch die Forderung des § 5 a Deutsches Richtergesetz, wonach der Volljurist zum Erwerb eines Hintergrundwissens auch mit den philosophischen und gesellschaftlichen Grundlagen des Rechts vertraut sein muss. Diese Kritik an der gegenwärtigen Ausbildung wird übrigens in dem im Jahre 1997 veröffentlichten Aufruf (NJW 1997, S. 2935 ff) von mehr als 30 namhaften Juristen aus Wissenschaft und Rechtsprechung geteilt, ohne dass sich allerdings seitdem etwas geändert hat.
Gerade jene Fächer, die mit recht als die „Grundlagen“ der Rechtswissenschaft bezeichnet werden – Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie usw. – spielen in der universitären Ausbildung heute kaum noch eine Rolle. Einige Universitäten besitzen nicht einmal Lehrstühle für diese Fächer.
Erst recht hat man davon abgesehen, diese Fächer im Pflichtfachstoff zu verankern. Angesichts der zunehmenden Verdichtung des Studiums, gerade bei zunehmender Stofffülle im Bereich flüchtigen Wissensstoffes, liegt es nahe, dass sich die Studierenden bei der Entscheidung für eines der Wahlfächer eher gegen die Wahl eines Grundlagenfaches entscheiden. Es ist eine Binsenweisheit, dass die Ausbildung und was der angehende Jurist in sein Lernen einzubeziehen bereit ist, von den Prüfungen determiniert wird. Das gilt auch und gerade für die juristischen Staatsexamina. Praktisch ist die Rechtsgeschichte als prüfungsrelevantes Fach aus den Studienplänen verbannt worden.
Folglich wissen die Absolventen der Juraausbildung nichts von den Ursachen, aus denen Juristen mit einer – in rechtstechnischer Hinsicht – soliden Ausbildung gewissermaßen über Nacht zu Mördern in der Robe werden konnten. Die heutigen Juristen wissen nichts über die juristischen Täter und die hinter ihrem Tun stehende Mentalität. Sie kennen auch nicht die Namen solcher Juristen, die – weil sie sich dem Unrecht verweigerten oder gar Widerstand leisteten – uns heute als Vorbilder dienen könnten. Solche Namen sagen ihnen nichts mehr: Namen wie Gustav Radbruch, Max Hirschberg, Hermann Heller, Franz L. Neumann, Otto Kirchheimer, Ernst Fraenkel. Nicht einmal die Namen kritischer Juristen der Zeit nach 1945: Fritz Bauer, Adolf Arndt, Richard Schmid oder Wolfgang Abendroth.
Ist die Verbannung der Rechtsgeschichte aus der Ausbildung gewollt?
Das Verschwinden der Rechtsgeschichte aus der Ausbildung ist allerdings kein Zufall. Die Rechtsgeschichte ist nicht etwa nur finanziellen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen. Könnte es sein, dass der nachdenkliche, kritische Jurist als Störfaktor gilt, der jederzeit fungible Jurist aber als Ideal? Aus der Sicht der Inhaber der politischen Macht ist Juristen die Funktion zugewiesen, die Macht nicht zu kontrollieren, sondern zu legitimieren. Das steht im Gegensatz zu dem Richterbild des Grundgesetzes. Wenn Art. 97 GG die Richter unabhängig, also von jeglichen politischen Vorgaben unabhängig stellt, ist damit nicht nur die äußere Unabhängigkeit, die Freiheit von formellen Weisungen gemeint. Das Richterbild des Grundgesetzes fordert den eigenständig denkenden, seine Berufsrolle kritisch reflektierenden Juristen.
An dem im denkenden Gehorsam handelnden Juristen sind diejenigen, die an den Schaltstellen der Herrschaft sitzen, aber nicht interessiert. In ihrem Sinn funktioniert Recht als Rahmen und Mittel moderner Herrschaft nur insoweit, als Juristen die der Justizpraxis zugrunde liegenden Mechanismen nicht verstehen oder nicht reflektieren wollen. Juristen, die diese Mechanismen durchschauen, sind unerwünscht. Einer, der später allerdings selbst den Weg der Opportunität vorgezogen hat, hat gesagt, die juristische Ausbildung sei nichts anderes als das Zurechtstutzen „auf die Vorstellungen, Erwartungen und Normen der etablierten Gesellschaft“ (Rudolf Wassermann, Erziehung zum Establishment, Neuwied 1969).
Ist das der Grund für die Vertreibung der Rechtsgeschichte, der Rechtssoziologie und der anderen Grundlagenfächer von den Universitäten? Oder liegt es auch daran, dass auch viele Hochschullehrer in ihrer eigenen Ausbildung nicht die Zeit hatten, diese Mechanismen zu reflektieren? Von hier aus erklärt sich jedenfalls, dass die in den siebziger Jahren unternommenen, inzwischen völlig eingeschlafenen Versuche, die Juristenausbildung durch die Integration sozialwissenschaftlicher Ausbildungsinhalte zu reformieren, sich sofort mit dem Vorwurf der Politisierung konfrontiert sahen.
Nicht noch einmal „furchtbare Juristen“
Was ist von Juristen zu erwarten, die von rechtshistorischen Kenntnissen unbeschwert sind, die in keinem rechtsphilosophischen Seminar über „Gerechtigkeit“, „Rechtsgeltung“ oder den Unterschied zwischen Recht und Moral nachdenken konnten? Auch nicht darüber, dass in jedem Staat, auch in der Demokratie bisweilen auch Widerspruch angemeldet werden muss? Werden diese Juristen den Zumutungen eines neuen autoritären Regimes widerstehen?
Wie ein Jurist sich in einem solchen Staat verhalten wird, entscheidet sich nicht erst im absoluten Ernstfall, sondern schon vorher: in Ausbildung und Sozialisation. Gerade die Fähigkeit zum Widerspruch, zum Nein-Sagen muss rechtzeitig eingeübt werden; in Zeiten, in denen dies noch gefahrlos möglich ist. Ausschließlich mit rechtstechnokratischem Wissen ausgestattete Juristen bieten schon heute nicht die Gewähr, jederzeit für den demokratischen Rechtsstaat einzutreten, wenn er machtpolitischen Gefahren ausgesetzt ist.