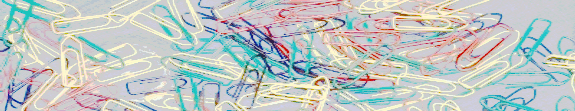Alles mit rechten Dingen?
Zur Entstehungsgeschichte und zum Missbrauch des Rechtsberatungsmissbrauchgesetzes von 1935
Helmut Kramer
58 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft und nachdem man die braune Vorgeschichte längst zu den Akten gelegt glaubte, sieht sich die deutsche Justiz und die Rechtspolitik mit einem besonders bemerkenswerten Erbe der Jahre 1933-1945 konfrontiert.
Worum geht es: Darf der Rechtsstaat es seinen Bürgern verwehren, Freunde, Nachbarn oder Selbsthilfegruppen um Rat zu bitten, wenn sie Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen, vielleicht sogar Opfer justizförmigen Unrechts werden? Die Frage erscheint absurd. Tatsächlich gibt es ein solches Verbot nirgendwo – mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist der einzige Staat, in dem es den Bürgern nicht erlaubt ist, in Rechtsdingen Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen. Tun sie dies doch, so werden zwar nicht sie bestraft, wohl aber die Ratgeber, gleichwie ob sie unentgeltlich oder kommerziell gehandelt haben. So steht es im Rechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935.
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Verbot der altruistischen Rechtsberatung sind bislang von den meisten Gerichten mit dem abstrakten Hinweis auf die Schutzzwecke des RBerG abgeschmettert worden. Im Vordergrund soll der „Schutz der Rechtsuchenden vor unsachgemäßer Rechtsberatung“ stehen. Was aber – an altruistischer Nachbarschaftshilfe – müsste der Rechtsstaat dann alles verbieten, wenn es um den Schutz vor der Inanspruchnahme von mit Gefahren verbundener Hilfe geht! Man denke etwa an elektrische Installationen, Autoreparaturen u. a. gefahrenträchtige handwerkliche Verrichtungen. Gibt es etwa einen gesetzlichen oder richterlichen Schutz des Verbrauchers vor unqualifizierten, ja mitunter geradezu kriminell vorgehenden unseriösen, auf hohe Provisionen ausgehenden Finanzberatern und die hinter ihnen stehenden Banken? Weil es diesen Schutz nicht gibt, sind an die 300.000 Bürger um ihre meist mühselig zusammengebrachten Ersparnisse gebracht worden. Der Bundesgerichtshof hat nicht einmal von den rechtlich vorhandenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, um den von den Vermittlern hereingelegten Käufern von nicht zu vermietenden Eigentumswohnungen (sog. Schrottwohnungen) zu helfen, obwohl das Zusammenwirken von Vermittlern und Banken auf der Hand lag. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Richter des betreffenden BGH-Senats eng mit dem Finanzgewerbe verbunden sind, einschließlich wirtschaftlich interessanter Treuhandverträge und Referententätigkeiten.
Doch es bleibt dabei: Im Unterschied zu manchen weitaus gefahrenträchtigeren Beratungsbereichen, bei denen eine gewisse Kontrolle im Interesse des Bürgers durchaus diskutabel erscheint, bleibt ausgerechnet die altruistische Rechtsberatung weiterhin verboten. Dieselben Politiker und Juristen, die unermüdlich Selbstverantwortung und Deregulierung predigen, halten an der Bevormundung des auf unentgeltlichen Rechtsrat angewiesenen Bürgers durch das RBerG fest.
Dabei ist das Bedürfnis nach einer leicht zugänglichen Rechtsberatung, durch altruistisch handelnde Bürger, aber auch durch Selbsthilfegruppen und gemeinnützige Verbände heute größer denn je. Wer sich als kritisch reflektierender Jurist in unserer Gesellschaft, und nicht nur unter Seinesgleichen, mit offenen Ohren bewegt, kann nicht überhören: Mit der Teilhabe des Bürgers am Recht ist nicht alles zum Besten gestellt. Die Diskriminierung der altruistischen Rechtsberatung beschreibt sogar nur einen kleinen Teil der drastischen Unterversorgung großer Bevölkerungsgruppen im Rechtsbereich. Angesichts der sprunghaften Zunahme der zugelassenen Rechtsanwälte (zur Zeit ungefähr 135.000) ist das auf den ersten Blick eine überraschende Feststellung. Weil die Mandate sich in manchen Rechtsbereichen (u. a. Recht der Sozialhilfe, Sozialversicherungsrecht usw.) aber für den Anwalt nicht „rechnen“, finden die Leute in solchen Rechtskonflikten aber meist keinen zu engagiertem Einsatz bereiten Anwalt. Das Ergebnis („weil du arm bist, kriegst du weniger Recht“) ist zwar grundsätzlich nichts Neues. Neu ist aber die Verrechtlichung von immer mehr Lebensbereichen von existentieller Bedeutung.
Leider kümmern sich die verantwortlichen Juristen auch nicht darum, ob der von der Anwaltschaft proklamierte hohe berufsethische Anspruch immer mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Zwar gibt es Rechtsanwälte, die sich auch für wenig zahlungskräftige Mandanten aufreiben. Das ist aber nur eine Minderheit. Andere Anwälte machen sich bei „kleinen Mandaten“ die Sache oftmals sehr leicht, mit oberflächlichen, aus wenigen Sätzen bestehenden Schriftsätzen, in denen sich bei schiefer Rechtsdarstellung gelegentlich nicht einmal der tatsächliche Sachverhalt wiederfindet. Die Möglichkeit, den nachlässig arbeitenden Rechtsanwalt regresspflichtig zu machen, steht meist nur auf dem Papier. Wenn der Anwalt nicht ganz eindeutige Regeln, wie z. B. Fristvorschriften u. dergl., verletzt hat, sind Schadensersatzansprüche erfahrungsgemäß aussichtslos. Hier würde nur eine intensivere Standesaufsicht Abhilfe bringen. Doch drücken die Anwaltskammern aus falsch verstandener Kollegialität bei noch so großer Nachlässigkeit beide Augen zu, wenn es nicht gerade um die Veruntreuung von Mandantengeldern geht (übrigens habe ich selbst dann übergroße Milde gegenüber kriminellen Anwälten beobachtet, sei es aus Mitleid, sei es, weil die Ehrengerichte oder Strafgerichte angesichts einer trickreichen Verteidigung wohl den Weg der größten Bequemlichkeit bevorzugen).
Auch die Qualität der Justiz selbst ist nicht mehr über jeden Zweifel erhaben. Das hat zum Teil mit der Überlastung der Gerichte zu tun. Vor allem die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten – man denke nur an die vielen Kündigungsschutzklagen im Gefolge der „Freisetzung“ von Arbeitskräften – haben zu einem Ansteigen der Prozesse geführt. Die Ware Recht ist allgemein zu einem knappen Gut geworden. Angesichts mancher unverständlicher Entscheidungen von Gerichten und Staatsanwaltschaften fragt man sich allerdings nach dem Grad der Professionalität und dem richterlichen Selbstverständnis, das hinter solchen Entscheidungen steht. Mitunter produzieren Staatsanwälte und Richter, die ihre wirkliche oder angebliche Arbeitsüberlastung so beredt beklagen, diese Überlastung selbst. Dies lässt sich mit mehr als nur vereinzelten Beispielen belegen. So etwa durch allzu forsches Vorgehen mancher Staatsanwälte in Bagatellsachen – im Unterschied zu mitunter geringem Engagement gegenüber der Wirtschaftskriminalität – oder durch flüchtige Bearbeitung provozierte Einlegung von Rechtsmitteln, wobei nicht alle Rechtsmittelgerichte sorgfältiger als die erste Instanz verfahren.
Wer im Glashaus sitzt ...
Die Rechtsanwälte und anderen Apologeten des RBerG werfen ihre gegen die altruistische Rechtsberatung gerichteten Angriffe aus dem Glashaus heraus: Die an Oberflächlichkeit kaum zu überbietende Art, in der Gerichte und Rechtsanwaltskammern mit dem RBerG umgegangen sind, spricht nicht gerade für die Annahme einer haushohen Überlegenheit der Juristen über den Nichtjuristen, der zwar nicht Jura studiert, aber als engagierter Bürger und Demokrat mit kritischem Blick auf die Rechtspraxis juristische Erfahrung gesammelt hat. Was die Juristenausbildung den angehenden Juristen an technokratischem Wissen vermittelt hat, ohne sie zugleich im kritischem Hinterfragen ihrer Methode einzuüben, beeinträchtigt mitunter ihre Fähigkeit, ihnen ungewohnte Lebenssachverhalte unvoreingenommen zu beurteilen.
Dichtung und Wahrheit – Die Entstehungsgeschichte des RBerG
Es ist schon merkwürdig: einerseits gelten wir Deutschen als besonders gesetzesgläubig. Andererseits hat uns die Entstehung unserer Gesetzesbücher nie besonders interessiert. An den Ursprung des RBerG hat bislang kein einziger unserer vielen hochdotierten Ordinarien für Rechtsgeschichte einen Gedanken verschwendet. Dabei ist die Entstehungsgeschichte des „Gesetzes zur Verhütung von Missbräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung“ vom 13.12.1935 (RG Bl. 1935 I S. 1478) besonders interessant.
Die meisten Juristen sehen in ihrer geschichtslosen Vorstellungswelt das RBerG bereits dadurch als von nationalsozialistischem Gedankengut als entsorgt an, dass eine in der 1. Ausführungsverordnung enthaltene antisemitische Vorschrift (§ 5: „Juden wird die Erlaubnis nicht erteilt“) inzwischen aufgehoben ist. Unbegründet sei die Annahme, das RBerG habe eine ausgesprochen nationalsozialistische Tendenz oder es handele sich überhaupt um ein Gesetz politischer Natur (Chemnitz/Johnigk, RBerG, 11. Aufl. 2003, S. 11). Nach Rechtsanwalt Felix Busse, früher Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, greift sogar „tief unter die Gürtellinie“, wer das Gesetz als Relikt aus der NS-Zeit bezeichne (NJW 1999, S. 1084). Damit wird es schlicht für unzulässig erklärt, in die Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes rechtsgeschichtliche Fakten einzubeziehen. Übrigens wählt der prominente Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Hamm genau die entgegengesetzte Methode, um nachzuweisen, dass dem Altbundeskanzler Helmut Kohl bitteres Unrecht geschehen sei, als man die Einstellung des Verfahrens im Parteispendenkomplex von der Zahlung einer Geldbuße abhängig gemacht habe, anstatt Kohl absolute Unschuld zu attestieren, denn: Der Untreueparagraph sei in der Nazi-Zeit entstanden. Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 41, 378, 390) verengt die Entstehungsgeschichte des RBerG auf die offizielle, die Gesetzesziele unverfänglich darstellende Gesetzesbegründung – so als würden totalitäre Machthaber ihre inhumanen, rechtsstaatwidrigen Absichten stets lautstark an die große Glocke hängen.
Was die Urheber des Gesetzes außerhalb der offiziellen Rechtsbegründung selbst zu ihren Zielsetzungen gesagt haben, wird von den Apologeten des RBerG ignoriert. Keiner von ihnen scheint gelesen zu haben, was die hinter dem Gesetz stehenden nationalsozialistischen Juristen – der Gesetzentwurf war weitgehend in Parteilokalen vom Bund Nationalsozialistischer Juristen (BNSJ) erstellt worden (vergl. Raeke, Juristische Wochenschrift 1936, S. 1; König, RBerG, Bonn 1993, S. 92) – selbst zu den Gesetzeszwecken gesagt haben. Die „wissenschaftliche Nacht“ (Kleine-Kosack), die die mit dem Anwaltsrecht befassten Rechtswissenschaftler jahrzehntelang über das RBerG verhängt haben, verdunkelte auch die Rechtsgeschichte. Und so konnte die erst vor wenigen Jahren brüchig gewordene Legende von der unter Hitler sauber gebliebenen Justiz dem RBerG bis zuletzt zugute kommen.
Tatsächlich bildete das Rechtsberatungsmissbrauchgesetz den Schlussstein der mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 eingeleiteten Maßnahmen zur Vertreibung und „Unschädlichmachung“ der aus ihren Berufen verjagten jüdischen und sonst politisch missliebigen Juristen. Nachdem sie aus Justiz und Anwaltschaft „entfernt“ worden waren, war ihnen wenigstens die Möglichkeit gegeben, das erworbene Fachwissen durch – sei es unentgeltliche – Beratung von Gesinnungsgenossen und anderer Bürger anzuwenden. Diese Möglichkeit sollte durch das RBerG vom 13.12.1935 unterbunden werden – das Gesetz als Kampfinstrument gegen politisch nicht genehme Rechtsberatung. Dass letztlich die Ausschaltung von jüdischen und sonst politisch missliebigen Rechtsberatern und nicht die von „Winkeladvokaten“ ausgehende Gefahr der Anlass für das Gesetz war, ergibt sich aus zahlreichen (unveröffentlichten) Eingaben aus der „völkisch“ gesonnenen Anwaltschaft an Regierungsstellen (vergl. König, RBerG, S. 19): den aus ihren Ämtern und Berufen vertriebenen Juristen dürfe nicht der Weg in die nichtanwaltliche Rechtsbesorgung offen bleiben.
Ganz anders als die verschleiernde offizielle Gesetzesbegründung nahmen auch die offiziellen Vertreter der nationalsozialistischen Anwaltsorganisationen kein Blatt vor den Mund, um der Forderung nach Eliminierung der nicht zur „Volksgemeinschaft“ zählenden Juristen Nachdruck zu verleihen. Ganz offensichtlich ging es um jene „Kollegen“, die Hans Frank auf einer Tagung am 22. November 1935 als „unwürdige Elemente“ den Anwälten gleichstellte, „die als echte Juden in deutschen Gerichtssälen die Dekadenzjuristerei einer vergangenen Epoche fortführten und die deutschen Rechtsstätten zu Börsenplätzen ihres händlerischen Geistes zu erniedrigen versuchten“ (Hans Frank, Juristische Wochenschrift, 1935, S. 3449). Im Zuge der nationalsozialistischen Feindbekämpfung sollte die juristische Intelligenz als Faktor in einem Beruf mit ausgeprägtem Politikbezug von jeder Einflussnahme ausgeschaltet werden (vergl. auch Kramer, Kritische Justiz 2000, S. 602). Am Rechtsleben mitwirken durften nur noch die amtlich zugelassenen Juristen. Diese unterlagen ja der politischen Kontrolle durch die Standesaufsicht. Und in den „Richtlinien für die Ausübung des Anwaltsberufs“ vom 2.7.1934 hieß es: „wird ein Anwalt in die Notwendigkeit versetzt, einen Schädling am Volk oder Staat zu vertreten, so muss er dabei jederzeit die Belange des deutschen Volkes beachten“. Die verjagten Juristen galten als Staatsfeinde: „Es sind übrigens nicht die ehrlichen Rechtsbeistände, die durch das Gesetz betroffen werden, denn diese haben ja in der Rechtsfront ihren Platz gefunden, es sind vielmehr Volksschädlinge, die gerade eben diese ehrliche und korrekte Rechtsbeistandschaft aus ihren Reihen ausschaltet und verwirft, und diesen Leuten muss natürlich in weitestem Umfang das Handwerk gelegt werden.“ Diese Zielsetzung traf sich mit arbeitsmarktpolitischen Gründen. Die Entlassung der politisch unerwünschten Juristen brachte eine Entlastung des Stellenmarktes, mit der sich die Machthaber auch bei dem Juristennachwuchs anbiedern konnten (vgl. Kramer, KJ 2000, S. 603).
Nach der mit der verlogenen offiziellen Gesetzesbegründung von 1935 übereinstimmenden offiziellen Lesart von heute, die gleichfalls mit der Rechtswirklichkeit wenig zu tun hat, bezweckt das RBerG vor allem den Schutz des einzelnen Bürgers, dem Individuum. Auch dem stehen zahlreiche unmaskierte Verlautbarungen der NS-Funktionäre entgegen. Gerade die obersten Funktionäre der NS-Anwaltschaft predigten den Grundsatz „Du bist nichts, Dein Volk ist alles“. So distanzierte sich einer der ranghöchsten Funktionäre der NS-Anwaltschaft Erwin Noack vom Schutz des einzelnen Bürgers durch das Recht: „Der Liberalismus führte Staat, Gesellschaft und Wirtschaft ganz auf den Einzelmenschen, auf das Individuum zurück. Der Einzelmensch war der Ausgangspunkt aller Betrachtungen; (... ) in ungehemmter Rücksichtnahme auf die Interessen der Gemeinschaft; dass der Einzelmensch der Ausgangspunkt aller Betrachtungen sei, (ist) ein Grundsatz, der dem Wesen eines jeden Ariertums widerspricht. (...) Der Gesetzgeber nimmt nicht mehr auf die Belange des Einzelmenschen Rücksicht. ...Wir haben durch unseren Führer die liberalistisch-egoistische Idee der Vergangenheit überwunden. Wir konnten aufgrund der Tatsache, dass die Rechtsbetreuung einen Vertrauensberuf darstellt, der in die innerste Seele des Volkes dringt, dazu gelangen.“ (Rechtsanwalt Prof. Dr. Erwin Noack, JW 1936, S. 32 f).
Solche Worte sollten den Verteidigern des RBerG in den Ohren klingen. Juristen sind, selbst wenn sie längst widerlegt sind, aber um Argumente nicht verlegen. In Kenntnis der offenherzigen Verlautbarungen der NS-Juristen argumentieren sie jetzt vielleicht ja so: „Die Nationalsozialisten haben ein richtiges Gesetz mit falscher Begründung erlassen. Wir bundesdeutschen Juristen haben aber das Gesetz mit richtiger Begründung übernommen.“ Auch hier genügt es, die NS-Juristen selbst zu Wort kommen zu lassen. Für sie war das am 13.12.1935 verkündete Gesetz ein „Gesetzgebungswerk, das im marxistischen-liberalistischen Parteienstaat eine völlige Unmöglichkeit gewesen wäre, das nur auf dem festen Boden nationalsozialistischer und berufsständischer Weltanschauung entstehen konnte und in jahrelanger Arbeit vorbereitet wurde unter dem Bund „National-Sozialistischer Deutscher Juristen“ (Raeke, Dienst am Recht, jw 1936, S. 1). Ähnlich äußerte sich Ministerialrat im Reichsjustizministerium Dr. Martin Jonas. Auch für ihn war „der Versuch der Änderung (des liberalen Grundsatzes der Gewerbefreiheit. (Anm. H. K.) im parlamentarischen Zeitalter ein vergebliches Unterfangen. Auch hier hat erst der Umbruch den Weg zu einer neuen gesunden Entwicklung freigemacht“ (Jonas, Deutsche Justiz 1935, S. 1817).
Verschärfung des Gesetzes im Jahre 1980
Nicht nur das Gesetz selbst ist ein typisches Produkt des Nationalsozialismus. Auch die rigoros ausufernde Anwendungspraxis ist – gegen zurückhaltende Stimmen aus dem RJM – von nationalsozialistischen Juristen begründet worden (Näheres dazu vgl. Kramer KJ 2000, S. 605). Diese Rechtsprechung des nationalsozialistischen Reichsgerichts (Urteil vom 9.8.1938, RGSt 72, 313) hat der Bundesgerichtshof unkritisch übernommen und zur „herrschenden Meinung“ erklärt.
Nicht einmal damit hat sich die Anwaltslobby zufrieden gegeben: Auf ihr Betreiben hin hat der Bundestag im Jahre 1980 die Möglichkeit abgeschafft, für die unentgeltliche Rechtsberatung eine Erlaubnis zu beantragen, also ein absolutes Verbot der altruistischen Rechtsberatung beschlossen – ein wohl einmaliger Fall, in dem der demokratischer Gesetzgeber ein NS-Gesetz noch verschärft hat (vgl. Kramer, KJ 2000, S. 606). Das Gesetz von 1935 hatte – mit Ausnahme der Juden – wenigstens theoretisch die Möglichkeit der Erlaubniserteilung für jeden Bürger vorgesehen.
Die Umstände, unter denen die „Gesetzesreform“ 1980 stattfand, erfordern nahezu kriminalistischen Spürsinn. Die mit dem Gesetzentwurf befassten Juristen scheinen sich der Fragwürdigkeit des absoluten Verbots ausgerechnet der altruistischen Rechtsberatung – für die kommerzielle Rechtsberatung sind weiterhin teilweise Erlaubnisse vorgesehen – bewusst gewesen zu sein. Mehrere Eigentümlichkeiten des Gesetzgebungsverfahrens deuten auf eine Verschleierungs- und Täuschungsabsicht hin:
Man wählte eine Gesetzesformulierung, aus der sich die Einführung eines absoluten Verbots für die unentgeltliche Rechtsberatung erst bei sehr gründlichem Lesen und Nachdenken erschließt. Wollte man die Kontrolle durch kritische Abgeordnete und durch eine demokratische Öffentlichkeit unterlaufen? Befremdlicherweise fehlt im dem Gesetz von 1980 das Wort „nur“ (in dem Gesetz von 1935 hieß es noch: „Die Erlaubnis darf nur erteilt werden“). Auch die in der Hand der Lobbyisten liegende Kommentarliteratur vermeidet geflissentlich eine deutliche Klarstellung, spricht dunkel und unvollständig von einer „Schließung des Berufs des Rechtsbeistandes“ und umkreist die peinliche Rechtsfolge – absolutes Verbot der unentgeltlichen Rechtsberatung, keine Erlaubnismöglichkeit – mit einem verbalen Eiertanz. Noch immer fallen selbst Rechtsmittelgerichte auf den undeutlichen Gesetzestext herein und halten wegen altruistischer Rechtsberatung belangten Bürgern vor, sie hätten es versäumt, eine Erlaubnis zu beantragen (so Beschlüsse des LG Bonn vom 31.10.2000 und des KG Berlin vom 20.11.2000).
Verdacht erregt auch, dass die bedeutsame Neuregelung nicht als Änderung des RBerG in den Bundestag eingebracht worden ist, sondern – als sog. Artikelgesetz – unauffällig im Anhang des Fünften Gesetzes zur Änderung der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BGBl. I, S. 1503) untergebracht wurde; die bedeutsamste Regelung also nicht als selbständiges Gesetz, sondern im Anhang eines Gesetzes mit zweitrangigem, nämlich gebührenrechtlichem Inhalt!
Nicht weniger merkwürdig: Die Neuregelung wurde erst zu einer Zeit nach Beratung im Rechtsausschuss des Bundestages in den Entwurf jenes Fünften Gesetzes zur Änderung der Rechtsanwaltsgebührenordnung eingeschmuggelt, ohne dass die Einbeziehung des ungleich bedeutsameren Rechtsberatungsgesetzes im Titel des Gesetzentwurfs zum Ausdruck gebracht wurde. Das merkwürdige Gesetzesgemisch wurde vom Deutschen Bundestag zu später Abendstunde ohne Aussprache verabschiedet. Dass es noch bedeutendere Fälle einer Rechtsänderung durch die „gesetzgeberische Hintertür“ gibt (vgl. u. a. Ingo Müller, Furchtbare Juristen, München 1986, S. 246 f; Kramer, in: Wolfram Wette/Gerd R. Ueberschär, Hg., Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert, S. 493 ff), beruhigt nicht, sondern sollte dazu ermuntern, dem Gesetzgeber auch bei seinem Procedere genauer auf die Finger zu schauen.
Fazit:
Das RBerG wurzelt nicht nur zeitlich im NS-Staat. Auch ein großer Teil seines Inhalts verdankt seine Entstehung der NS-Ideologie. Als wohl einziges von den 1.973 antisemitischen Gesetzen und Rechtsverordnungen der Jahre 1933-1945 ist das RBerG noch heute in Kraft. Seine Geschichte ist vom Anfang (1935) bis zum hoffentlich alsbaldigen Ende eine Geschichte der Verschleierungen und Unredlichkeiten. Alle Versuche zur Ehrenrettung dieses auch rechtstechnisch missglückten und nicht praktikablen Gesetzes sind gescheitert. Derselbe Staat, dieselbe Justiz, die sich den Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus auf ihre Fahnen geschrieben haben, tun sich schwer, das nationalsozialistische RBerG aufzuheben und durch eine komplette Neuregelung mit liberalem Inhalt zu ersetzen.
Erst in der letzten Zeit ist einiges in Bewegung geraten. Die Berliner Regierungskoalition hat in ihrer Koalitionsvereinbarung von 2002 eine Reform des RBerG beschlossen. Das BVerfG wird voraussichtlich im Jahre 2004 über das Verbot der unentgeltlichen Rechtsberatung entscheiden. Und das BVerwG in Leipzig hat zu einem Teil des RBerG wörtlich ausgeführt: „Die rechtliche Bewältigung dieses Vorgangs kann nicht mehr auf der Grundlage einer vor mehr als einem halben Jahrhundert unter einem mit heutigem rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht zu vereinbarendem Rechtssystem erlassenen Rechtsverordnung erfolgen, sondern bedarf der Bewertung durch den Gesetzgeber“ (BVerwG NJW 2003, 2769). Was das BVerwG hier zur 5. Ausführungsverordnung des RBerG gesagt hat, lässt sich getrost auf das gesamte Gesetz beziehen.