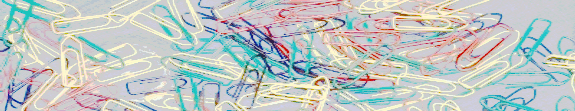Entsorgung des Reichskriegsgerichts
Entsorgung des Reichskriegsgerichtes
WDR3
Tageszeichen
Profit statt Erinnerung
Die Entsorgung des ehemaligen Reichskriegsgerichtes in Berlin
Autor: Helmut Kramer
Sendedatum: 7. August 2007
Redaktion: Gabriele Gillen
Moderation:
Für das Unrechtssystem der nationalsozialistischen Justiz stehen neben vielen kleineren und mittleren Gerichte vor allem die beiden höchsten Gerichte des Dritten Reiches, beide in Berlin: Zunächst der Volksgerichtshof, dessen Gebäude im Zweiten Weltkrieg total zerstört wurde, sodann das Reichskriegsgericht. Es residierte in der Berliner Witzlebenstraße, in einem Anfang des 19. Jahrhunderts als Reichsmilitärgericht errichteten Gebäude. Neben dem ehemaligen Reichsgericht in Leipzig handelt es sich um die bundesweit wichtigste Erinnerungsstätte zur NS-Justiz. Der im Wilhelminischen Stil errichtete Prachtbau ist unversehrt geblieben, unversehrt jedenfalls bis noch vor einem Jahr.
Profit statt Erinnerung.
Ein Beitrag von Helmut Kramer:
Beitrag:
Nachdem das seit 1951 vorübergehend in der Berliner Witzlebenstraße untergebrachte Berliner Kammergericht im Jahre 1999 wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgekehrt war, stellte sich nämlich die Frage: Was macht man mit dem ehemaligen Reichskriegsgericht[i], einem geschichtsträchtigen und architekturgeschichtlich bedeutsamen Bau, neben dem ehemaligen Reichsgericht in Leipzig die bundesweit wichtigste Erinnerungsstätte zur NS-Justiz? In seinen Mauern wurden allein in der Zeit des Zweiten Weltkrieges mindestens 1.400 Todesurteile gefällt, gegen Widerstandskämpfer in Deutschland und den besetzten Ländern, gegen Wehrkraftzersetzer, Kriegsdienstverweigerer und gegen die Mitglieder der „Roten Kapelle?
Es hätte nahe gelegen, dort eine in Berlin, überhaupt in der gesamten Bundesrepublik bislang noch immer fehlende Gedenk- und Dokumentationsstätte einzurichten, mit der Erinnerung an die grausame Wehrmachtsjustiz und darüber hinaus an die mörderische NS-Justiz insgesamt, auch an die beschämende Art der Aufarbeitung in den Jahrzehnten nach 1945. Ein Angebot dafür gab es schon: die kürzlich auf den Weg gebrachte Wanderausstellung zur NS-Militärjustiz, für die es sonst keine dauerhafte Unterbringungsmöglichkeit gibt. Auch benötigt die aus allen Nähten platzende Berliner Justiz dringend weitere Räumlichkeiten, u. a. für einen zweiten Landgerichtsbezirk und eine zweite Staatsanwaltschaft. Für all das hielten der Eigentümer, die Bundesvermögensverwaltung, und die zu beteiligende Stadt Berlin den historischen Bau viel zu schade. Man suchte nicht nach Erinnerung oder Respekt, man suchte nach einer wirtschaftlich lukrativen Verwertung. „Hier muss doch was gehen: Irgend etwas Tolles, Repräsentatives“, rief der Berliner Tagesspiegel – und die Berliner Behörden folgten dem begeisterten Ruf und somit den Begehrlichkeiten der auf neue Vermögensanlageprojekte bedachten Investoren.
Unverständlicherweise machte auch die Denkmalschutzbehörde mit und ließ ihre anfänglichen Bedenken fallen. Schließlich ging es in dem nicht zuletzt vom Berliner Bankenskandal gebeutelten Stadtstaat darum, die Immobilie möglichst günstig und ohne Gedankenverschwendung zu vermarkten. Und so verkaufte man das Gebäude an eine holländische Investorengruppe, die Firma allod Immobilien- und Verwertungsgesellschaft. Um darin für gut betuchte Bürger mehr als 100 so genannte Schlosslofts als luxuriöse Mietwohnungen einzurichten, ließ diese das Gebäude bis zur Unkenntlichkeit umgestalten. Zahlreiche Zwischenwände, Zwischendecken und Galerien wurden eingezogen, das Treppenhaus wurde getäfelt. Vortragssäle, in denen einst Todesurteile gesprochen wurden, werden künftig als gemütliche Wohnzimmer dienen, mit wie Schwalbennester eingebauten Bädern und Schlafzimmern. Garderoben, weitere Bäder und Küchen wurden wie Möbel in die Gerichtsflure gestellt. Dort sieht man nur noch die Gewölbedecken. Schon im kommenden November werden die ersten Mieter in das Atrion – so der künftige Name – einziehen.
Gegenüber einer informierten, kritischen Öffentlichkeit wären die rigorosen Eingriffe in die Innenarchitektur kaum durchsetzbar gewesen. Eine solche Öffentlichkeit gab es aber nicht. Die wohlunterrichtete Berliner Presse wahrte Stillschweigen. Als wolle sie den Deal ungestört vonstatten gehen lassen. Vor allem der Tagesspiegel hatte offenbar erkannt, dass es im Zeichen der Privatisierung nun auch historischer Gebäude mehr auf schnelle Gewinnmaximierung als auf behutsamen Denkmalschutz ankommt. Erst als mit fortgeschrittenem Baubeginn vollendete Tatsachen geschaffen waren, sah der Tagesspiegel die Zeit für eine Berichterstattung gekommen (Ausgabe v. 21.07.2007). Anstelle einer Darstellung der Problematik, nämlich des Konfliktes zwischen Denkmalpflege und Erinnerungskultur sowie den vermeintlichen kommerziellen Zwängen, rührte er die Werbetrommel für die prächtigen Mietwohnungen. Unter Anpreisung der „begehrten Wohnlage am Lietzensee“ lobte der ganzseitige, mit großformatigen Farbabbildungen der Wohnungen garnierte Bericht, wie sehr die Teilung der großen Räume in kleine „gelungen“ sei. Viele Geschäftsführer, Vorstände und Firmeninhaber hätten sich die bisher zu 50 Prozent vermieteten Wohnungen schon gesichert. Muss man sich also beeilen? Redaktionelle Werbung nennt man so was. Verschwiegen wurde auch, dass nicht einmal die Gebäudefassade unverändert bleibt. Es werden nämlich Balkone angehängt. Doch an weniger gut betuchte Leser, die Mietpreise bis zu 18 € pro qm für die bis zu 220 qm großen Wohnungen nicht aufbringen können, dafür aber an den Einzelheiten der auf Kosten des Denkmalschutzes getroffenen Entscheidung der Behörden interessiert sind, richtete sich der Artikel wohl ohnehin nicht. Befriedigt erwähnt wurde nur, dass der Regisseur Dani Levy kurz vor Beginn der Bauarbeiten in den Räumen des ehemaligen Reichskriegsgerichtes noch den Film „Mein Führer“ habe drehen können. Das sei für das Haus „ein guter Abschluss des dunkelsten Teils seiner Geschichte“. So sieht es auch der Geschäftsführer der allod Immobilien- und Vermögensverwertungsgesellschaft Thomas Grothe in seiner Antwort auf die Frage des Tagesspiegel, wie er denn mit der NS-Vergangenheit des Gebäudes umgehe: „Diese Zeit macht zum Glück nur einen Bruchteil der ‚Lebenszeit’ des Gebäudes aus.“ Dass sich viele Berliner in Kenntnis der Vorgeschichte des Hauses für eine Wohnung im Atrion entschieden hätten, zeige nur, „dass sie nach vorn sehen“. Eine Schlussstrichmentalität, die sich mit der Weigerung der Bundestagsmehrheit trifft, die vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilten Kriegsverräter zu rehabilitieren.
[1] Vgl. Norbert Haase, Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft. Berlin 1993;vgl. Manfred Messerschmidt, Die Wehrmachtsjustiz 1933-1945. Paderborn 2005, S. 49-51, 95-133; Wolfram Wette und Detlef Vogel, Das letzte Tabu, NS-Militärjustiz und „Kriegsverrat“. Berlin 2007;
Helmut Kramer, „Landesverrat hat immer und zu allen Zeiten als das schimpflichste Verbrechen gegolten.“ Das Verfahren der Staatsanwaltschaft Lüneburg von 1951 gegen den Generalrichter a.D. Manfred Roeder, in: Wolfram Wette und Detlef Vogel, ebenda S. 69-88.